Social Media zerstört die moderne Gesellschaft – und alle machen mit
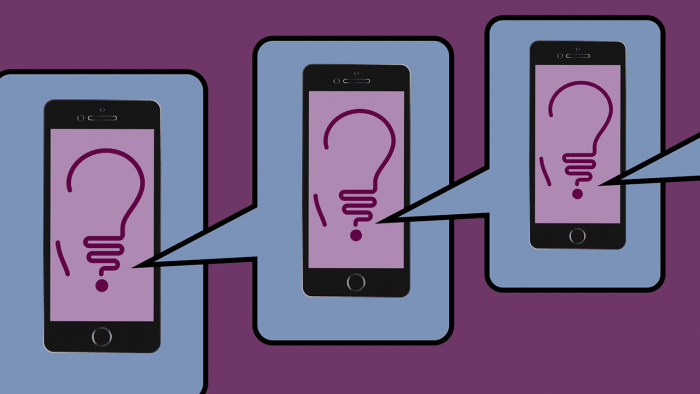
Social Media prägt unsere Gesellschaft. Persönliche Profile verdrängen Sachlichkeit. Droht das Ende der Moderne? (Teil 2 und Schluss)
Disprivilegierung von Moral in der modernen Gesellschaft
Kennzeichnend für die moderne, funktional differenzierte Gesellschaft ist, dass der Zugang zu den verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen nicht mehr personen-, sondern sach- bzw. leistungsorientiert erfolgt. Prinzipiell ist es jeder Person möglich – unter der universalisierten Perspektive allgemeiner Menschenrechte – Richter, Manager, Papst, Wissenschaftler, Journalist, Minister etc. zu werden.
Oder spezifischer: Sie können nach Maßgabe ihrer oft zunächst überprüften Leistungsfähigkeit Mitgliedschaft in der modernen Vielfalt von Organisationen (etwa als Arbeitsstellen) erlangen – unabhängig von Stand und Klasse.
Dabei wird das Potenzial der Leistungsfähigkeit von Personen selbst wiederum auf sachliche Weise erzeugt bzw. überprüft. Dies geschieht mittels des Funktionssystems für Erziehung und Bildung, dessen Zugang idealerweise unabhängig von Kriterien abseits individueller Leistungsfähigkeit wie Geschlecht, Hautfarbe oder ökonomisches Potenzial sein soll.
Damit soll nicht behauptet werden, dass es sich bei der modernen (westlichen?) Gesellschaft um eine perfekte Meritokratie handeln würde. Es lässt sich leicht zeigen, dass sowohl die Bildung als auch die ökonomische Leistungsfähigkeit der Eltern einen erheblichen Einfluss auf die Bildungschancen des Nachwuchses haben.
Ebenso absurd wäre es, davon auszugehen, dass Reichtum keine Rolle mehr spielen würde, um politische Ämter zu erlangen, oder dass Reputation und gar Ruhm nicht dazu taugten, einen Kaffee kostenlos zu bekommen.
Entscheidend ist jedoch, dass Vorkommnisse dieser Art immer noch als störend empfunden werden, mit politischen Programmen bekämpft und allenfalls der Justiz als Korruption zugeführt werden oder zumindest (vorgeblich) als peinlich empfunden werden.
Mit diesen Ausführungen sollte klar geworden sein, dass sich die Moderne zumindest tendenziell durch die Privilegierung sachbezogener Aspekte nach Maßgabe funktionaler Systeme wie Politik, Wirtschaft und Wissenschaft sowie das Zurückdrängen personenbezogener, moralanfälliger Ansprüche auszeichnet.
Die Anerkennung der professionellen Leistungen von Medizinern, Wissenschaftlern, Politikern, Journalisten, Pfarrern oder Managern tritt (oder trat?) gewissermaßen zurück hinter die Kategorie der persönlichen Achtung bzw. Missachtung. Zumal persönliche, mündliche Kommunikation erfordernde Begegnungen in der Schriftkultur der Moderne kein zwingendes Erfordernis mehr sind.
Personalisierung und Privilegierung von Moral durch Nutzerprofile
Vor diesem Hintergrund lässt sich nun verstehen, was das radikal Neue an der Kommunikation unter den Bedingungen sozialer Medien ist. Strukturell ist diese an stabile Nutzerprofile gebunden, anhand derer sich Kommunikation – die zudem auf unabsehbar lange Zeit gespeichert werden kann – stets persönlich zurechnen lässt.
Mit den sozialen Medien wurde eine Form der Kommunikation etabliert, die gesellschaftlich die Kategorie der Persönlichkeit auf Kosten von Sachlichkeit bzw. Leistungsfähigkeit privilegiert und auf diese Weise eine Beobachtung nach moralischen Kategorien wahrscheinlich macht.
Gesellschaftlich tonangebend wird die Beobachtung von Personen in ihrer Totalität nach Maßgabe von Achtung bzw. Missachtung. Dagegen tritt die Beobachtung nach Kategorien professioneller oder sachlicher Leistungsfähigkeit zurück.
Es zeigt sich also, dass die schriftliche Form der Kommunikation nicht zwangsläufig die Tendenz hat, Personalität zugunsten von Sachlichkeit zu privilegieren. Die Struktur der Nutzerprofile in den sozialen Medien erzwingt, dass – wie in vormodernen Zeiten – die Kategorie des Persönlichen vor dem Sachlichen an Dominanz gewinnt.
Aktuell lässt sich dies in gesellschaftlichen Ausprägungen wie z. B. der "Cancel Culture", "identitären" Strömungen, "woken" bzw. "anti-woken" Protestbewegungen oder durch "Shitstorms" befeuerten, "Public Shaming" verursachenden, modernisierten sozialen Prangern beobachten.
Früher waren persönliche, mündliche Kommunikation erfordernde Begegnungen face-to-face flüchtig, auf Episoden beschränkt und gaben dem Vergessen – derart moralische Beobachtung moderierend – eine Chance.
Heute werden durch jahrzehntelang stabile Nutzerprofile Begegnungen (selbst mit körperlich Abwesenden) hingegen stets auf Persönlichkeit hin fokussiert. Es sind die Themen der gespeicherten Kommunikationsgeschichte, die mittlerweile flüchtig sind, während die Zurechnung der Kommunikation auf Personen hyperstabil ist und somit anfällig für Moral.
Das korrumpierende Potential sozialer Medien
Wie in einem Brennglas lassen sich diese gesellschaftlichen Entwicklungen anhand des Phänomens Donald Trump beobachten. Vor der Kategorie der Achtung bzw. Missachtung seiner Person tritt jegliche Bewertung seines destruktiven faktischen bzw. sachlichen Handelns zurück.
Die sachliche Eigenständigkeit und Leistungsfähigkeit gesellschaftlicher Sphären wie der Wissenschaft, der Justiz oder der Massenmedien wird moralischen Beobachtungskategorien, etwa "anti-woken", untergeordnet und damit korrumpiert.
Dabei ist erneut festzuhalten: Trump spielt lediglich die Rolle eines aktuell prägnanten gesellschaftlichen Symptoms für Entwicklungen, die durch einen radikalen Wandel der dominanten Form der Kommunikation verursacht wurden und die Gesellschaft prägen.
Lässt sich diesen Entwicklungen etwas entgegensetzen? Etwa durch die Durchsetzung von "Netiquette"? Oder durch Bildungskampagnen im Allgemeinen und die Vermittlung von "Medienkompetenz" oder "Anti-Hate-Speech"-Kampagnen im Besonderen?
Durch regulatorische Maßnahmen gegenüber Plattformbetreibern oder schlicht durch individuellen digitalen Detox? Lässt sich dem kommunikativ verursachten moralischen Überschwang der Gesellschaft also erfolgreich selbst moralisch entgegnen? – Nein.
Die aktuellen Entwicklungen, die die moderne Gesellschaft bedrohen, sind durch eine radikale Änderung der dominanten Kommunikationsform der Gesellschaft bedingt. Sie betreffen gewissermaßen die DNA der modernen Gesellschaft.
Bislang zeichnete sich die Form der Kommunikation dadurch aus, dass sie Personalität und Moralität de-privilegierte und stattdessen einen Fokus auf Leistungsfähigkeit und Sachlichkeit – konkret mit Blick auf die spezialisierte Autonomie von Funktionssystemen wie Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Religion, Massenmedien oder Kunst – privilegierte. Die Dominanz der sozialen Medien kehrt dieses Verhältnis um: Sie privilegiert auf Kosten der Sachlichkeit einen moralisch aufgeladenen Fokus auf die Persönlichkeit.
Versteht man die Gesellschaft als Organismus, dessen funktionale Differenzierung den organisch separierten Sphären dieses Lebewesens entspricht, dann erscheinen die Nutzerprofile in ihrer Vielzahl wie schon weit gestreute Metastasen, die die organische bzw. funktionale Differenzierung auflösen bzw. korrumpieren.
Oder, nochmals anders gewendet: Die Selbstheilungskräfte der modernen Form der Gesellschaft konnten noch problemlos mit dem flüchtigen und fallweisen Auftreten von Stammtischen in ihrer körperlichen Präsenz fertig werden.
Wenn die Gesellschaft jedoch durch die Struktur langjährig stabiler Nutzerprofile selbst in einen monströsen Stammtisch verwandelt wird – zu einem "global village", dem allerdings die Nestwärme der physisch-psychischen Präsenz von Personen in ihren lokalen Formen abgeht – wird sich ihre Form radikal verändern, allen "Netiquetten" zum Trotz.1

